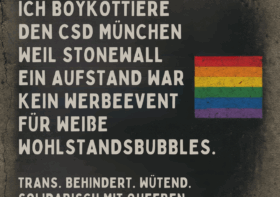Hate Speech: Worte auf der Haut – Schreie der Seele

Von der individuellen Scham durch Hate Speech zur kollektiven Kampfansage: Die befreiende Aneignung verletzender Begriffe.
Die Luft während des Shootings war schwer, fast erstickend. Als meine damalige Freundin mir diese Worte „Hure“, „Transe“, „Krüppel“, „Missgeburt“, „Eklige“ auf die Haut schrieb und eine ehemalige Assistentin die Kamera hob, war der Raum still. Kein Lächeln, kein Smalltalk. Nur der sanfte Druck des Stifts auf meiner Haut, das leise klicken der Kamera im Hintergrund und das Gewicht einer ganzen Biografie aus Hass, das sich auf meinen Körper legte. Jeder Buchstabe war eine Narbe der Erinnerungen, jede Linie ein Echo aus einer Zeit, in der diese Worte mich kleiner machen sollten. Dort zu liegen, diese teilweise jahrzehntelang gehörten Beleidigungen bewusst zu tragen, war ein Akt der Selbstentblößung und des Widerstands zugleich. Denn wie sonst macht man hasserfüllte Sprache sichtbar, wenn nicht, indem man ihr ins Gesicht schaut und sie zurückwirft?
Eine präzise Waffe des Hasses
Hate Speech ist kein rein sprachliches Phänomen, sondern eine Waffe, die sehr präzise trifft. Jede Wiederholung schneidet tiefer ins Selbstbild, jeden Tag ein Schnitt mehr, der die Psyche aushöhlt. Die Wirkung ist kumulativ: Ein einzelner Angriff mag abprallen, doch die ständige Wiederholung verändert neuronale Muster, verankert Misstrauen und Angst in Körper und Geist. Ableistische, queerfeindliche, sexistische, misogyne und lookistische Angriffe brennen sich ein, bis Betroffene beginnen, diese Lügen selbst zu glauben. Angst wird zur ständigen Begleiterin, ein Schatten, der jede Bewegung prüft. Der Rückzug wird zur Überlebensstrategie, das Ausweichen zur Routine. Diese erzwungene Unsichtbarkeit frisst sich ein, bis man sie für Normalität hält und genau das ist der Punkt, an dem Hass seine größte Macht entfaltet. Er verändert nicht nur das Verhalten, sondern auch den inneren Dialog, den man mit sich selbst führt. Man beginnt, sich in Spiegeln zu untersuchen, als wolle man prüfen, ob die Worte schon Spuren hinterlassen haben, und merkt nicht, wie sehr sie längst das eigene Selbstbild verzerrt haben.
Die psychologischen Folgen von Hate Speech sind tief. Wiederholte Anfeindungen aktivieren das Stresssystem des Körpers immer wieder aufs Neue. Cortisol, Adrenalin, das Gefühl, ständig auf der Hut sein zu müssen. Dauerstress kann zu Angststörungen, Depressionen und sogar zu körperlichen Erkrankungen führen. Er raubt Schlaf, Konzentration, Freude an Dingen, die man früher geliebt hat. Manche entwickeln ein übersteigertes Misstrauen, andere ziehen sich sozial völlig zurück. Diese Reaktionen sind nicht Zeichen von Schwäche, sondern Überlebensmechanismen in einer feindlichen Umgebung. Doch sie verändern, wie man lebt, wem man vertraut, wie sehr man sich überhaupt noch zeigt.
Seid furchtlos und dadurch stark
Irgendwann begriff ich: Der Hass anderer Menschen bestimmte mein Leben, mein Selbstbild, meine Entscheidungen, meine Freiheit. Er diktierte, wie ich mich bewege, was ich sage, wohin ich gehe. Es war ein unsichtbares Drehbuch, nach dem ich spielte, ohne es je geschrieben zu haben. Irgendwann schwor ich mir, dass ich das nie wieder zulassen würde. Das klingt oft leichter, als es ist. Furchtlosigkeit muss man üben, manchmal jeden Tag neu, manchmal gegen den eigenen Instinkt. Doch ich lernte, dass genau diese Furchtlosigkeit eine Macht in sich trägt: die Macht, mein Leben frei und selbstbewusst zu gestalten, und die Macht, den Hatern ihre Waffe zu entreißen. Wenn ich die Begriffe, die mir wie Ketten angelegt wurden, selbst benutze, in meinem Kontext, mit meiner Stimme, dann reiße ich anderen Menschen die Deutungshoheit aus der Hand. Ihr Hass verliert sein Gift und ich gewinne an Raum. Es ist ein Prozess, ein ständiges Austarieren zwischen Selbstschutz und Angriff, zwischen Verletzlichkeit und Stärke, zwischen dem Heilen alter Wunden und dem Verhindern neuer.
Einer dieser Begriffe ist „Hure“. Dieses Wort wurde mir unzählige Male entgegengeschleudert. Ein moralisches Urteil, als Versuch, meine Sexualität zu kontrollieren, als Waffe, um mich zu beschämen. „Hure“ war nie nur ein Wort, es sollte ein Angriff auf meine Würde sein, ein Stempel, der mir aufgedrückt wurde, um mich in eine Schublade zu sperren. Irgendwann erkannte ich, dass diese Zuschreibung nicht mein Makel war, sondern ihr Werkzeug. Die Aneignung dieses Wortes wurde zu einem Akt der Befreiung: Wenn ich mich selbst als „Hure“ bezeichne, tue ich das zu meinen Bedingungen. Ich entziehe dem Wort die Scham, nehme ihm die giftige Moral, mit der es beladen wurde. In feministischen, sexpositiven und queeren Kreisen ist „Hure“ längst ein Begriff des Stolzes geworden, ein Symbol für sexuelle Selbstbestimmung, für das Recht auf Lust, für die Weigerung, patriarchalen Reinheitsfantasien zu gehorchen. Indem ich es für mich beanspruche, erkläre ich offen: Eure moralischen Maßstäbe haben keine Macht über mich. Diese Umdeutung ist mehr als ein persönlicher Schutzmechanismus, sie ist eine politische Kampfansage und ein Mittel, anderen Betroffenen zu zeigen, dass sie sich nicht vor einem Wort verneigen müssen.
„Queer“ war einst Spott und ist heute ein stolzer Kampfruf. „Krüppel“, einst jahrzehntelang ein Schimpfwort, wurde in der Behindertenbewegung zum Banner des Protests. „Schlampe“ wird von Slutwalks ins Gegenteil verkehrt, um Victim Blaming zu zerschlagen und sexuelle Freiheit zu bekräftigen. Reclaiming ist reine Selbstermächtigung, es ist das Zurückholen der Deutungshoheit. Aber diese Macht gehört nur den Betroffenen, nicht den Täter*innen. Sie ist ein Schild und ein Schwert zugleich und beides will gelernt sein. Manchmal ist sie ein Schutzmantel, manchmal ein Rammbock. Immer ist sie ein Statement, das sagt: Ich definiere mich selbst.
Reclaiming bedeutet Widerstand
Das Foto über diesem Artikel ist eine Zumutung. Schon während seiner Entstehung war es eine Zumutung und das muss es auch sein. Es reißt die Illusion nieder, dass Hass folgenlos bleibt. Es zwingt dazu, hinzusehen, zu fühlen, mitzuschwimmen in diesem Meer aus Scham, Wut und Trotz. Die aufgemalten Worte sind nicht nur Farbe, sie sind eine Landkarte aus Narben, die viele von uns tragen, sichtbar oder unsichtbar. Sie erzählen Geschichten, die sich nicht ausradieren lassen und sie fordern ihre Zuhörenden heraus, nicht wegzusehen. Genau deshalb ist dieses Bild politisch: Es sagt, wir existieren. Wir werden gesehen. Wir lassen uns nicht mehr ausradieren.
Wir brauchen mehr als Lippenbekenntnisse gegen Hate Speech. Wir brauchen Schutzräume, Solidarität, Konsequenzen und eine klare gesellschaftliche Ansage: Menschenfeindlichkeit ist kein legitimer Diskussionsbeitrag. Jeder Angriff, jedes Wort, jede Tat muss beantwortet werden, laut, unbequem, unübersehbar. Wir müssen lernen, dass die Rückeroberung dieser Worte, in unserer eigenen Form, nicht nur ein Selbstschutz ist, sondern ein Angriff auf die Strukturen, die sie hervorgebracht haben. Wir müssen verstehen, dass wir dabei nicht nur für uns kämpfen, sondern für jede Person, die jemals unter den gleichen Worten zusammengezuckt ist und dass es unsere Aufgabe ist, ihnen zu zeigen, dass man auch daraus Stärke ziehen kann.
Denn am Ende geht es nicht um mich oder um ein einzelnes Bild. Es geht um eine kollektive Erfahrung, die Millionen Menschen teilen. Das Erleben, dass Sprache töten kann, nicht nur den Körper, sondern auch Träume, Selbstvertrauen, Zugehörigkeit. Dieses Bild ist mein Teil eines größeren Archivs des Widerstands, eine visuelle Anklage gegen all jene, die glauben, Worte seien harmlos. Sie sind es nicht. Deshalb werden wir sie den Hatern nicht kampflos überlassen.