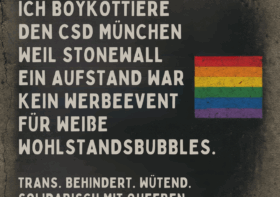Gaza: Ein vergifteter „Friedensplan“

Der Vorschlag von Donald Trump über die Situation in Gaza klingt zunächst wie ein pragmatisches Angebot: Wiederaufbau, Sicherheit, wirtschaftliche und humanitäre Hilfen. Bei näherer Betrachtung offenbart sich jedoch ein anderes Gesicht.
Auf den ersten Blick wirkt das Papier von Donald Trump wie ein lang erhofftes Geschenk. Es verspricht humanitäre Hilfe, einen Wirtschaftsplan und internationale Garantien; Wörter wie „Stabilisierung“ und „Wiederaufbau“ dominieren die Rhetorik. Diese Begriffe sind bewusst gewählt: Sie klingen praktisch, apolitisch, lösungsorientiert und wecken die Hoffnung auf ein Ende des Gemetzels und auf Frieden.
Doch genau darin liegt die Gefahr. Indem der Plan das Politische in technische Maßnahmen übersetzt, verschleiert er grundlegende normative Fragen. Wem gehört Land, wer entscheidet über Grenzen, wer trägt die Verantwortung für vergangene und gegenwärtige Gewalt?
Der Plan wird nicht als Ergebnis eines inklusiven Dialogs präsentiert, sondern als Vorschlag, der rasch umgesetzt werden soll. Diese Form der Vorlegung ist kein bloßes Stilmittel: Sie ist strategisch. Ultimative Angebote setzen Fristen, erzeugen Druck und zwingen jene, die ohnehin asymmetrisch positioniert sind, Entscheidungen unter Zwang zu treffen. Für die palästinensische Bevölkerung bedeutet das: politische Teilhabe, Schutzansprüche und Selbstbestimmung werden auf einen Prüfstand gestellt, dessen Kriterien andere festlegen.
Völkerrechtliche Brüche und politische Mechanismen
Drei Aspekte erscheinen besonders problematisch: erstens die Rechtslage, zweitens die Depolitisierung, drittens die einseitige Gewichtung von Sicherheitsinteressen.
Der Plan sieht die Einrichtung einer „Sicherheits‑Pufferzone“ vor, die de facto Teile des Gazastreifens tangieren würde. Solche Maßnahmen sind in ihrer Wirkung mit territorialen Eingriffen verwandt und werfen schwerwiegende Fragen nach Besatzungsrecht und Souveränität auf. Internationales Recht kennt klare Regeln zur Versorgung der Zivilbevölkerung in Konflikten: Humanitäre Hilfe darf nicht als Druckmittel verwendet werden. Die Idee, Hilfslieferungen an die Einhaltung einer Feuerpause zu koppeln, ist nicht nur moralisch fragwürdig, sie berührt auch das Verbot, Hunger als Kriegswaffe zu verwenden.
Statt politische Prozesse und Mitbestimmung in den Vordergrund zu stellen, reduziert der Plan palästinensische Regierungsorganisationen auf Implementierungsrollen: Verwaltung, Dienstleistung, Ausführung. Die vorgeschlagene „reformierte PA“ steht nicht für Souveränität, sondern für konditionierte Administration. Externe Stabilisierungstruppen und Kontrollmechanismen verlagern die Macht von der lokalen Bevölkerung hin zu internationalen oder externen Akteur*innen. Daraus entsteht eine Treuhandlogik, formal delegierte Zuständigkeiten, faktisch entzogene Selbstbestimmung.
Außerdem gibt es eine extreme Asymmetrie der Sicherheitsforderung. Während der Plan wiederholt die Notwendigkeit der „Deradikalisierung“ palästinensischer Gruppen betont, fehlen vergleichbare Forderungen an israelische Eliten: Demilitarisierung, verbindliche Mechanismen für Rechenschaft oder der Ausschluss von Personen, gegen die Haftbefehle bestehen, sind nicht Kern des Vorschlags. In einem Kontext, in dem internationale Institutionen bereits Ermittlungen und Anordnungen vorsehen, ist dieses Ungleichgewicht kein Versehen, sondern strukturelle Verzerrung.
Der politische Kontext: Warum „Groß‑Israel“ relevant ist
Politische Vorschläge lassen sich nicht isoliert betrachten. Aussagen führender Politiker prägen die strategische Einordnung eines solchen Plans. Wiederholt hat Benjamin Netanjahu visionäre Äußerungen geäußert, die den Begriff eines erweiterten israelischen Einflussbereichs nahelegen. Diese rhetorischen Signale, die auch in der deutschen Berichterstattung kritisiert wurden, geben dem Papier eine Lesart, die über kurzfristige Sicherheitsüberlegungen hinausgeht: Es geht nicht nur um Wiederaufbau, sondern möglicherweise um territoriale Neuordnungen und demographische Strategien.
Wenn ein Plan in ein narratives Umfeld eingebettet ist, das die Expansion des Einflussbereichs als legitimes Ziel versteht, verändert dies seine Praxisfolgen. Maßnahmen, die auf dem Papier als „Sicherheitsvorkehrungen“ deklariert werden, können in der Realität zu dauerhaften Machtverschiebungen führen. Damit wird das Vorhaben zu einem Instrument, das nicht nur Konflikte zu managen behauptet, sondern langfristig die politische Karte der Region umzeichnet.
Folgen für den Alltag: Instrumentalisierung und Entmachtung
Für Menschen in Gaza und dem Westjordanland bedeuten solche Konstruktionen konkrete Einschränkungen: Bewegung, politische Organisation, Zugänge zu Ressourcen und Rechten werden verhandelbar und damit verletzlich. Die Palette reicht von administrativen Hürden für lokale Organisationen bis hin zu direkter wirtschaftlicher Verwundbarkeit, wenn Wiederaufbauprojekte primär auf externe Investoren ausgerichtet sind.
Außerdem besteht das Risiko, dass der „Wiederaufbau“ vor allem jenen nutzt, die das Kapital und die politischen Verbindungen mitbringen, während die breite Bevölkerung wenig profitiert. Damit verfestigt sich eine ökonomische Hierarchie, die den politischen Ausschluss weiter institutionalisiert.
Was die internationale Politik jetzt tun muss
Die Antwort kann nicht in der naiven Ablehnung von Verhandlungen bestehen, sie muss jedoch von völker- und menschenrechtlichen Prinzipien geleitet sein. Fünf konkrete Ansätze erscheinen dringend:
Keine Anerkennung des Plans als Legitimation für Fremdbestimmung: Staaten und internationale Organisationen dürfen dem Dokument nicht die Deutungshoheit über die palästinensische Bevölkerung und deren Selbstbestimmung überlassen.
Rechtsdurchsetzung stärken: ICC‑Haftbefehle und ICJ‑Anordnungen müssen ernstgenommen und umgesetzt werden.
Humanitäre Hilfe sichern: Der Zugang zu Hilfsgütern darf niemals instrumentalisiert werden.
Waffenexporte und Finanzhilfen prüfen: Politisch wie rechtlich begründete Restriktionen sind zu prüfen, wenn fortgesetzte Verstöße dokumentiert sind.
Partizipative Friedensprozesse fördern: Jede dauerhafte Lösung braucht die legitime Partizipation der Betroffenen und den Respekt vor deren Selbstbestimmungsrecht.
Keine Abkürzungen zum Frieden
Die Versuchung ist groß, in einem komplexen Konflikt nach schnellen Lösungskonzepten zu greifen. Doch echte Friedenspolitik ist nicht mit administrativen Puzzleteilen zu ersetzen. Sie verlangt Gerechtigkeit, Rechenschaft und die Achtung gleicher Rechte. Der vorliegende Vorschlag ist keine Abkürzung zu diesen Zielen; er ist vielmehr ein Instrument, das Machtverhältnisse zementiert und die Hoffnung auf eine gerechte, nachhaltige Lösung gefährdet.
Journalismus und linke Politik müssen in solchen Momenten mehr sein als eine einfache Orientierung: Man muss komplexe Zusammenhänge nachvollziehbar machen, ohne sie zu vereinfachen. Dieser Text will dazu anregen, die Fassade zu durchschauen und die Frage zu stellen, ob internationales Engagement nicht doch mehr leisten muss als Stabilisierung um den Preis politischer Entmachtung.